MENÜ
AT | EUR
AT | EUR
Es konnten keine Ergebnisse gefunden werden.
Such-Empfehlungen

Positivität - Optimistisch durchs Leben
Beyond Science
- Off the Bench
- Dossier
Positiv zu denken, ist nicht immer einfach – und hilft auch nur bedingt dabei, sich besser zu fühlen. Statt negative Gedanken rosa einzufärben, sollte man den Blick bewusst auf wirklich Positives lenken.
Wer mit dem Schlimmsten rechnet, ist auf alles vorbereitet. Und wer nichts erwartet, wird auch nicht enttäuscht. Eingefleischte Pessimisten leben nach dem Motto: „Es wird schon schiefgehen.“ Und so blicken sie jeden Morgen eher illusionslos dem Tag entgegen. Das Meeting mit dem Chef: Was soll das schon bringen? Das Brainstorming im Kollegium? Vergeudete Zeit. Ihren Tag voller negativer Selbstgespräche beenden Pessimisten dann mies gelaunt vor dem Fernseher – und fühlen sich nach den meist schlechten 20-Uhr-Nachrichten in ihrer Weltsicht bestätigt. „Denk doch mal positiv“ bekommen Pessimisten häufig zu hören. Tja, wenn das so einfach wäre. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer! Denk positiv, dann kannst du alles schaffen! In jeder Krise steckt eine Chance! Vermeintlich aufmunternde Glaubenssätze wie diese verbreiten zahlreiche Ratgeber, Influencer und andere wohlmeinende Experten nicht erst seit der Pandemie. Propagiert wird dabei der Versuch, das eigene Denken ständig positiv zu beeinflussen. Die Hoffnung hinter der Denkmethode, die keine therapeutische Maßnahme bei depressiven Erkrankungen darstellt: Eine optimistische Grundhaltung führt zu mehr Zufriedenheit und einem glücklicheren Leben.
Optimisten leben gesünder
Tatsächlich ist ein positiver Blick auf die Welt wichtig für unser Wohlbefinden. So zeigt beispielsweise ein Team um Alan Rozanski vom Mount Sinai St. Luke’s Hospital in New York, dass eine optimistische Grundhaltung das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen senkt, während Pessimisten ein höheres Risiko für Herzkrankheiten haben. Der Psychologe Martin Seligman von der University of Pennsylvania fand zudem heraus, dass Pessimisten, die ihre Misserfolge auf persönliche Schwächen zurückführen, viel häufiger an Depressionen leiden als Menschen, die ihre Misserfolge als Erfahrung abhaken und es in Zukunft besser machen wollen. In einer Studie mit Versicherungsverkäufern stellte er sogar einen Zusammenhang zwischen positiver Einstellung und Leistung fest: Optimistische Makler brachten 37 Prozent mehr Policen unter das Volk als Pessimisten. Eine Hirnscan-Studie der Stanford University zeigte, dass Positivität sogar die Gehirnleistung fördert. Die Forschenden untersuchten die Haltung von Grundschülern gegenüber dem Fach Mathematik. Sie stellten fest, dass eine positive Einstellung gegenüber der Welt der Zahlen das Gehirn beim Rechnen besser arbeiten läst.
Der Haken: Eine optimistische Grundhaltung lässt sich durch positives Denken allein kaum erreichen. Zum einen fällt es besonders Schwarzsehern schwer, ihre Gedanken so einfach umzupolen. Vor allem aber impliziert der wohlmeinende Ratschlag zum positiven Denken oft den Tipp, schlechte Gefühle beiseitezuschieben. Dabei werden mit der permanenten Schönfärberei negative Emotionen unterdrückt – und das kann Studien zufolge Stress auslösen.
Optimisten leben gesünder
Tatsächlich ist ein positiver Blick auf die Welt wichtig für unser Wohlbefinden. So zeigt beispielsweise ein Team um Alan Rozanski vom Mount Sinai St. Luke’s Hospital in New York, dass eine optimistische Grundhaltung das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen senkt, während Pessimisten ein höheres Risiko für Herzkrankheiten haben. Der Psychologe Martin Seligman von der University of Pennsylvania fand zudem heraus, dass Pessimisten, die ihre Misserfolge auf persönliche Schwächen zurückführen, viel häufiger an Depressionen leiden als Menschen, die ihre Misserfolge als Erfahrung abhaken und es in Zukunft besser machen wollen. In einer Studie mit Versicherungsverkäufern stellte er sogar einen Zusammenhang zwischen positiver Einstellung und Leistung fest: Optimistische Makler brachten 37 Prozent mehr Policen unter das Volk als Pessimisten. Eine Hirnscan-Studie der Stanford University zeigte, dass Positivität sogar die Gehirnleistung fördert. Die Forschenden untersuchten die Haltung von Grundschülern gegenüber dem Fach Mathematik. Sie stellten fest, dass eine positive Einstellung gegenüber der Welt der Zahlen das Gehirn beim Rechnen besser arbeiten läst.
Der Haken: Eine optimistische Grundhaltung lässt sich durch positives Denken allein kaum erreichen. Zum einen fällt es besonders Schwarzsehern schwer, ihre Gedanken so einfach umzupolen. Vor allem aber impliziert der wohlmeinende Ratschlag zum positiven Denken oft den Tipp, schlechte Gefühle beiseitezuschieben. Dabei werden mit der permanenten Schönfärberei negative Emotionen unterdrückt – und das kann Studien zufolge Stress auslösen.
Mehr erfahren
Weniger lesen

Stress durch „toxische Positivität“
Kommt der Druck zum positiven Denken von außen, kann das die negativen Gefühle sogar noch verstärken. „Eine übermäßige Betonung der Positivität gegenüber der Negativität kann eine unerreichbare emotionale Norm schaffen, die ironischerweise das individuelle Wohlbefinden beeinträchtigt“, so Egon Dejonckheere von der Tilburg University, der mit Kollegen aus 40 Ländern eine multinationale Glücksstudie im Magazin „Nature“ herausbrachte. Der wahrgenommene soziale Druck, sich nicht negativ zu fühlen, spiele eine auslösende Rolle bei Depressionen, so Dejonckheere. Besonders in Ländern mit einem höheren Weltglücksindex habe eben dieses hohe nationale Glücksniveau für einige Menschen auch Nachteile: Ihr Risiko für Depressionen steigt. Das Streben nach Glück und Perfektion verkehrt sich hier ins Gegenteil – ein Phänomen, das unter dem Schlagwort „toxische Positivität“ derzeit in den sozialen Netzwerken diskutiert wird.
Depressive Erkrankungen bedürfen einer professionellen Behandlung. Geht es aber darum, positiver durchs Leben zu gehen, bietet die Positive Psychologie eine vielversprechende Alternative zum positiven Denken. Die „Wissenschaft des gelingenden Lebens“ beschäftigt sich mit den positiven Aspekten des Menschseins wie Glück, Optimismus, Geborgenheit, Vertrauen, individuelle Stärken, Verzeihen oder auch Solidarität. In der Praxis fördert die Positive Psychologie eine positive Grundhaltung, indem sie den Fokus mithilfe regelmäßiger Übungen (siehe S. 20) gezielt auf Positives lenkt, das im wirklichen Leben passiert ist – ohne dabei Negatives auszublenden. Eine Blume, die aus dem Asphalt wächst, kann an einem trüben Tag ebenso Freude bereiten wie das Lob einer Kollegin oder ein Kompliment unseres Partners. Und statt mich über eine schlechte Präsentation zu ärgern, fokussiere ich mich auf das Positive: Ich hatte ein erfolgreiches Kundengespräch und habe später einer Freundin geholfen.
Weg von Schwächen und Defiziten
Konzentrierte sich die Psychologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch stark auf menschliche „Defizite“, betonte Martin Seligman Ende der 90er-Jahre als Präsident der American Psychological Association (APA) erstmals die Vorteile der Positivität für Glücksempfinden, Gesundheit und Erfolg. Seitdem beherrscht dieser Ansatz auch die psychologische Forschung. Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass uns positive Emotionen helfen, leichter mit den Unbilden des Lebens zurechtzukommen. Besonders wer von Kindesbeinen an gelernt hat, die Welt als einen guten Ort anzusehen, hat es im Leben leichter, fand ein Team um Angela Lee Duckworth von der University of Pennsylvania heraus. Menschen, die überzeugt waren, dass die Welt zwar Gefahren birgt, im Großen und Ganzen aber gut ist, kamen im Leben besser klar.
Leider sind viele von uns nicht mit einem solch sonnigen Gemüt gesegnet. Denn die Evolution hat uns gelehrt, wachsam zu sein und ständig auf Gefahren zu lauern. Als der Mensch noch vor Säbelzahntigern flüchten musste und in ständiger Lebensgefahr schwebte, sicherte ihm die „Fight-or-Flight-Reaktion“ (Kampf oder Flucht) das Überleben. Dieser Fokus auf Bedrohungen hat sich fest in unseren Gehirnen verankert. In der modernen Welt sorgt das allerdings für überflüssigen Pessimismus. Denn unser Leben ist nur noch selten in Gefahr. Dafür schaden Stress und negatives Denken unserer Gesundheit. Die größte Hürde auf dem Weg zu mehr Positivität sind folglich wir selbst.
Kommt der Druck zum positiven Denken von außen, kann das die negativen Gefühle sogar noch verstärken. „Eine übermäßige Betonung der Positivität gegenüber der Negativität kann eine unerreichbare emotionale Norm schaffen, die ironischerweise das individuelle Wohlbefinden beeinträchtigt“, so Egon Dejonckheere von der Tilburg University, der mit Kollegen aus 40 Ländern eine multinationale Glücksstudie im Magazin „Nature“ herausbrachte. Der wahrgenommene soziale Druck, sich nicht negativ zu fühlen, spiele eine auslösende Rolle bei Depressionen, so Dejonckheere. Besonders in Ländern mit einem höheren Weltglücksindex habe eben dieses hohe nationale Glücksniveau für einige Menschen auch Nachteile: Ihr Risiko für Depressionen steigt. Das Streben nach Glück und Perfektion verkehrt sich hier ins Gegenteil – ein Phänomen, das unter dem Schlagwort „toxische Positivität“ derzeit in den sozialen Netzwerken diskutiert wird.
Depressive Erkrankungen bedürfen einer professionellen Behandlung. Geht es aber darum, positiver durchs Leben zu gehen, bietet die Positive Psychologie eine vielversprechende Alternative zum positiven Denken. Die „Wissenschaft des gelingenden Lebens“ beschäftigt sich mit den positiven Aspekten des Menschseins wie Glück, Optimismus, Geborgenheit, Vertrauen, individuelle Stärken, Verzeihen oder auch Solidarität. In der Praxis fördert die Positive Psychologie eine positive Grundhaltung, indem sie den Fokus mithilfe regelmäßiger Übungen (siehe S. 20) gezielt auf Positives lenkt, das im wirklichen Leben passiert ist – ohne dabei Negatives auszublenden. Eine Blume, die aus dem Asphalt wächst, kann an einem trüben Tag ebenso Freude bereiten wie das Lob einer Kollegin oder ein Kompliment unseres Partners. Und statt mich über eine schlechte Präsentation zu ärgern, fokussiere ich mich auf das Positive: Ich hatte ein erfolgreiches Kundengespräch und habe später einer Freundin geholfen.
Weg von Schwächen und Defiziten
Konzentrierte sich die Psychologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch stark auf menschliche „Defizite“, betonte Martin Seligman Ende der 90er-Jahre als Präsident der American Psychological Association (APA) erstmals die Vorteile der Positivität für Glücksempfinden, Gesundheit und Erfolg. Seitdem beherrscht dieser Ansatz auch die psychologische Forschung. Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass uns positive Emotionen helfen, leichter mit den Unbilden des Lebens zurechtzukommen. Besonders wer von Kindesbeinen an gelernt hat, die Welt als einen guten Ort anzusehen, hat es im Leben leichter, fand ein Team um Angela Lee Duckworth von der University of Pennsylvania heraus. Menschen, die überzeugt waren, dass die Welt zwar Gefahren birgt, im Großen und Ganzen aber gut ist, kamen im Leben besser klar.
Leider sind viele von uns nicht mit einem solch sonnigen Gemüt gesegnet. Denn die Evolution hat uns gelehrt, wachsam zu sein und ständig auf Gefahren zu lauern. Als der Mensch noch vor Säbelzahntigern flüchten musste und in ständiger Lebensgefahr schwebte, sicherte ihm die „Fight-or-Flight-Reaktion“ (Kampf oder Flucht) das Überleben. Dieser Fokus auf Bedrohungen hat sich fest in unseren Gehirnen verankert. In der modernen Welt sorgt das allerdings für überflüssigen Pessimismus. Denn unser Leben ist nur noch selten in Gefahr. Dafür schaden Stress und negatives Denken unserer Gesundheit. Die größte Hürde auf dem Weg zu mehr Positivität sind folglich wir selbst.
Mehr erfahren
Weniger lesen
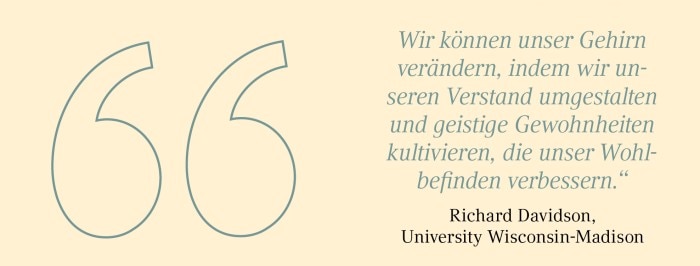
Unser Gehirn lernt immer dazu
Kann es den Pessimisten unter uns trotzdem gelingen, den Fokus auf das Positive zu lenken? Die gute Nachricht lautet: Ja! „Wir können unser Gehirn verändern, indem wir unseren Verstand umgestalten und geistige Gewohnheiten kultivieren, die unser Wohlbefinden verbessern“, sagt Richard Davidson von der University Wisconsin-Madison. Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit, Mitgefühl und emotionale Ausgeglichenheit seien in unserem Gehirn verankert und könnten durch Erfahrung und Training geformt und verändert werden. Davidson zufolge hat mentales Training zur Förderung des Wohlbefindens positive Auswirkungen beispielsweise auf den Arbeitsplatz – unter anderem auf Führung, Kreativität, Gesundheit der Mitarbeitenden, Produktivität und Zusammenarbeit.
Um Positivität zu lernen, braucht es keine Therapie, sondern nur regelmäßige Übung. Die kostenlose App „Healthy Minds Program“ beispielsweise, die Davidson mit seinem Team entwickelt hat, soll Menschen mit nur fünf Minuten Achtsamkeitstraining pro Tag helfen, ihr Leben positiv zu verändern. Die Alltagsmethoden der Positiven Psychologie zeigen oft erstaunliche Effekte. Cannabiskonsumenten etwa, die im Rahmen einer Studie zwei Wochen lang jeden Abend drei gute Dinge in ihrem Leben identifizierten, kifften danach deutlich weniger. Ob nun per App oder mit Alltagsmethoden: Wichtig sind regelmäßige Übungen. Dann lässt sich das Gehirn darauf trainieren, sich auf das Positive zu fokussieren. Dranbleiben lohnt sich also.
Kann es den Pessimisten unter uns trotzdem gelingen, den Fokus auf das Positive zu lenken? Die gute Nachricht lautet: Ja! „Wir können unser Gehirn verändern, indem wir unseren Verstand umgestalten und geistige Gewohnheiten kultivieren, die unser Wohlbefinden verbessern“, sagt Richard Davidson von der University Wisconsin-Madison. Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit, Mitgefühl und emotionale Ausgeglichenheit seien in unserem Gehirn verankert und könnten durch Erfahrung und Training geformt und verändert werden. Davidson zufolge hat mentales Training zur Förderung des Wohlbefindens positive Auswirkungen beispielsweise auf den Arbeitsplatz – unter anderem auf Führung, Kreativität, Gesundheit der Mitarbeitenden, Produktivität und Zusammenarbeit.
Um Positivität zu lernen, braucht es keine Therapie, sondern nur regelmäßige Übung. Die kostenlose App „Healthy Minds Program“ beispielsweise, die Davidson mit seinem Team entwickelt hat, soll Menschen mit nur fünf Minuten Achtsamkeitstraining pro Tag helfen, ihr Leben positiv zu verändern. Die Alltagsmethoden der Positiven Psychologie zeigen oft erstaunliche Effekte. Cannabiskonsumenten etwa, die im Rahmen einer Studie zwei Wochen lang jeden Abend drei gute Dinge in ihrem Leben identifizierten, kifften danach deutlich weniger. Ob nun per App oder mit Alltagsmethoden: Wichtig sind regelmäßige Übungen. Dann lässt sich das Gehirn darauf trainieren, sich auf das Positive zu fokussieren. Dranbleiben lohnt sich also.
Mehr erfahren
Weniger lesen
Verwandte Dokumente
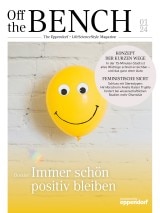
Magazin
PDF 13,52 MB
Folgeartikel lesen
Mehr erfahren
Weniger lesen
Dossier Folgeartikel Positivität
